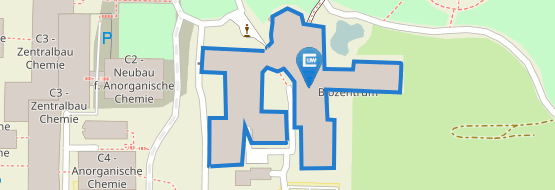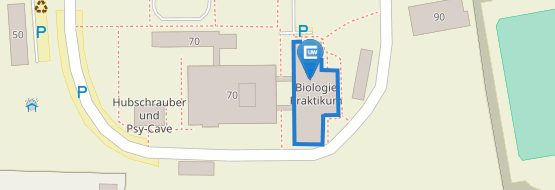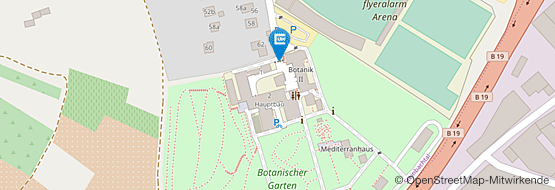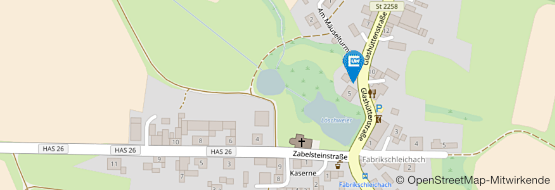Innere Uhren bestimmen das Auf und Ab des Antarktischen Krills
09.05.2025Antarktischer Krill reagiert mit seinem Verhalten nicht nur auf äußere Umwelteinflüsse wie Licht oder Nahrung. Er nutzt auch seine innere Uhr, um sich an die extremen Bedingungen der polaren Umwelt anzupassen.

Einzeln betrachtet macht Antarktischer Krill (Euphausia superba) keinen großen Eindruck. Mit einer Körperlänge von maximal sechs Zentimetern, einem Gewicht von gerade einmal zwei Gramm und seiner transparenten Haut wirkt er wenig spektakulär. Dabei spielt Krill eine zentrale Rolle für das Leben im Südpolarmeer. Milliarden dieser kleinen Krebstiere bilden nämlich riesige Schwärme, die sich über mehrere Quadratkilometer erstrecken können, und sind die wichtigste Nahrungsquelle für viele Raubtiere.
Ein Forschungsteam der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) hat jetzt in Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), dem Helmholtz Institut für Funktionelle Marine Biodiversität (HIFMB) in Oldenburg sowie dem National Oceanography Institut in Großbritannien das Verhalten dieses Meeresbewohners genauer unter die Lupe genommen. Die Gruppe interessierte sich dabei speziell für dessen „tägliche Vertikalwanderung in der Wassersäule“, wie es in der jetzt in der Fachzeitschrift eLife veröffentlichten Studie heißt.
Nahrung an der Oberfläche, Schutz vor Räubern in der Tiefe
„Antarktischer Krill nutzt nachts den Schutz der Dunkelheit, um an der Meeresoberfläche mikroskopisch kleine Algen zu fressen. Tagsüber suchen die Tiere dann in tieferen, dunkleren Schichten Schutz vor Räubern“, beschreibt Lukas Hüppe das periodische Auf und Ab im Südpolarmeer. Hüppe ist Erstautor der Studie und Doktorand am Lehrstuhl Neurobiologie und Genetik der JMU. Betreut wurde er von Bettina Meyer (AWI und HIFMB) und Charlotte Förster, der früheren Inhaberin dieses Lehrstuhls und heute dort weiter aktiven Seniorprofessorin. Innere Uhren bilden schon seit vielen Jahren einen Schwerpunkt von Försters Forschung. Dementsprechend stand bei diesem Projekt die Frage im Mittelpunkt, inwieweit die Krill-Wanderungen von inneren Uhren bestimmt sind.
Obwohl Krill mit seiner täglichen Wanderung erheblichen Einfluss auf die Durchmischung der Wassersäule und den Kohlenstofftransport in die Tiefsee ausübt, und trotz jahrzehntelanger Beobachtungen sind die genauen Mechanismen dieses Wanderverhaltens noch nicht vollständig verstanden. Für seine Studie hat das Forschungsteam deshalb jetzt zum ersten Mal einzelne wildgefangene Tiere über verschiedene Jahreszeiten hinweg in einem speziellen Aktivitätsmonitor untersucht.
Beobachtungen mit einer neuentwickelten Technik
Diesen Monitor hatten Forscherinnen und Forscher erst im Jahr 2024 entwickelt. Das neue Gerät macht es möglich, die Schwimmaktivität einzelner Lebewesen in mit Meerwasser gefüllten Röhren aufzuzeichnen. Für seine Experimente hatte Hüppe mit einem kommerziellen Fischereischiff Krill aus dem Südpolarmeer gefangen. An Bord konnte er mithilfe der neuen Technik die Bewegungen wild gefangener Krill unter verschiedenen Lichtbedingungen und zu verschiedenen Jahreszeiten erforschen.
Seine Beobachtungen zeigten, dass die Krebse nachts am aktivsten waren, was ihren natürlichen Wanderungsmustern in der freien Natur entspricht. Diese nächtlichen Aktivitätsmuster passten sich an die wechselnde Länge der Nacht im Laufe der Jahreszeiten an. Außerdem behielt der Krill einen täglichen Aktivitätsrhythmus bei, selbst wenn er mehrere Tage lang in konstanter Dunkelheit gehalten wurde.
Typischer Rhythmus auch in völliger Dunkelheit
Die Ergebnisse sind eindeutig: „Antarktischer Krill zeigt einen täglichen Rhythmus mit erhöhter Schwimmaktivität in der Nacht, was sehr gut zu der vertikalen Wanderung in der Natur passt“, erklärt Lukas Hüppe. Selbst in völliger Dunkelheit behielten die Tiere diesen Rhythmus über mehrere Tage bei – ein Beweis dafür, dass sie eine innere Uhr nutzen, um ihr Auf und Ab dem Tag-Nacht-Rhythmus anzupassen. Darüber hinaus zeigten die Experimente, dass Krill sein Verhalten flexibel mit sehr langen oder kurzen Tagen, wie sie nur in Polarregionen vorkommen, synchronisieren kann.
Damit steht fest: „Krill reagiert mit seinem Verhalten nicht nur auf äußere Umwelteinflüsse wie Licht oder Nahrung. Er nutzt auch seine innere Uhr, um sich an die extremen Bedingungen seiner polaren Umwelt anzupassen“, fasst Charlotte Förster das zentrale Ergebnis der Studie zusammen.
Bedeutung für das Ökosystem und das Klima
Auch wenn sich die Studie vordergründig mit physiologischen Prozessen im Inneren kleiner Meeresbewohner beschäftigt, geht die Bedeutung ihrer Ergebnisse doch weit darüber hinaus. „Das Südpolarmeer spielt als Kohlenstoffspeicher eine zentrale Rolle in der Regulierung des globalen Klimas. Diese Funktion basiert auf einem funktionellen, produktiven Ökosystem, in dessen Zentrum der Antarktische Krill steht“, erklärt Bettina Meyer. Die optimale Anpassung von Krill an seine Umwelt sei eine Grundvoraussetzung für gesunde Krill-Bestände.
Da Veränderungen in Krill-Populationen weitreichende Folgen für das gesamte Ökosystem des Südpolarmeeres haben können, ist ein besseres Verständnis der Anpassungsmechanismen entscheidend, um Voraussagen über die zukünftige Entwicklung der Bestände zu machen, so die Forschungsgruppe in ihrem Fazit.
In ihrem nächsten Projekt wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deshalb die innere Uhr genauer untersuchen. „Wir wollen verstehen, wo die Uhr im Gehirn von Krill tickt und wie der Mechanismus auf neuronaler Ebene funktioniert“, sagt Charlotte Förster. Dabei rücke auch die Frage in den Fokus, in welcher Art und Weise die innere Uhr andere wichtige Prozesse im Krill beeinflusst – beispielsweise die Fortpflanzung und seine Überwinterungsstrategien.
Originalpublikation
„A circadian clock drives behavioral activity in Antarctic krill (Euphausia superba) and provides a potential mechanism for seasonal timing“, Lukas Hüppe, Dominik Bahlburg, Ryan Driscoll, Charlotte Helfrich-Förster and Bettina Meyer. eLife, 29. April 2025. https://doi.org/10.7554/eLife.103096.3
Kontakt
Prof. Dr. Charlotte Förster, Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik, T: +49 931 31-88823, charlotte.foerster@uni-wuerzburg.de
Prof. Dr. Bettina Meyer, Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, T: +49 471 4831 1378/2535, bettina.meyer@awi.de
Lukas Hüppe, Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik, T: +49 931 31-84703, lukas.hueppe@uni-wuerzburg.de